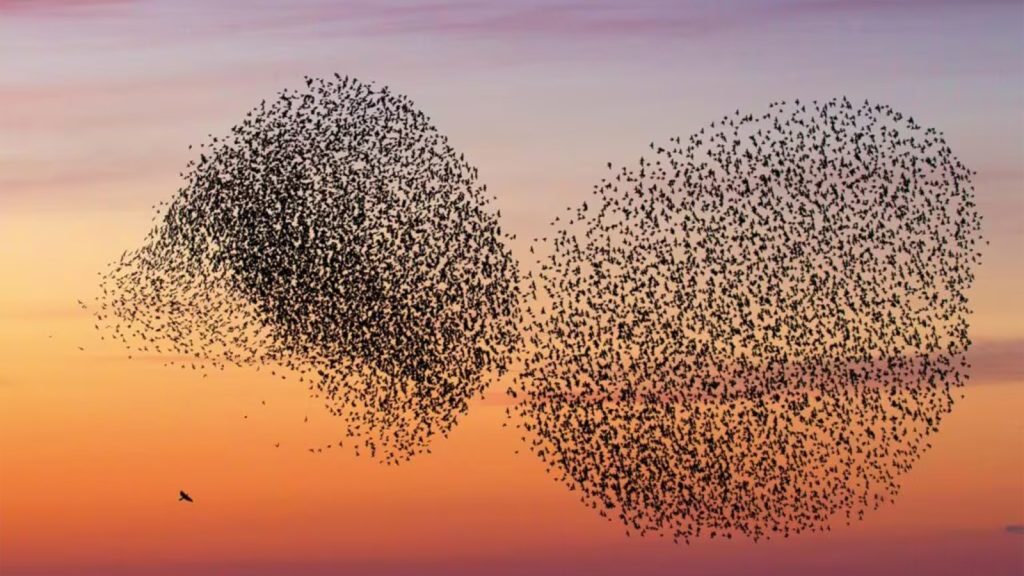Autor: Daniel Stüssi – Erschienen am 30. Oktober 2025 in der Weltwoche
Seit der Abschaffung physischer Wertpapiere liegt die Kontrolle über Vermögen bei wenigen zentralen Stellen. Was als Fortschritt gilt, entpuppt sich in der Krise als Achillesferse des Finanzsystems. Wer glaubt, Eigentum sei unantastbar, wird überrascht werden.
Das Vertrauen in die Infrastruktur der Kapitalmärkte ist die Voraussetzung des Privateigentums. Eine bedeutende Rolle fällt dabei auf die Zentralverwahrer zu, welche die börsenkotierten Wertpapiere für die Banken und Broker verwalten. Geht ein solcher Zentralverwahrer Konkurs, kann aus Wertschriften-Eigentum ein Datensatz ohne Zugriff werden. Im Jahr 2023 brachte der ehemalige Hedgefondsmanager David Rogers Webb das Buch «The Great Taking» (dt. Die grosse Enteignung) heraus. Webb löste mit seiner These, das globale Finanzsystem bereite eine verdeckte Enteignung der Anleger vor, erhebliche Diskussionen aus. Seine Recherchen führen in die Machtstrukturen der zentralen Verwahrstellen. Doch ist das Thema tatsächlich so brisant – und betrifft es auch Europäische oder Schweizer Wertpapiere? Ein Blick in die Rechtslage legt nahe: Die Grundmechanik ist überall ähnlich. Eigentum wurde in den vergangenen Jahrzehnten von der physischen in die elektronische Form verlagert, der Anleger wurde zum Gläubiger in einem abstrakten System. Der Unterschied liegt im Detail der Gesetze.
Im Insolvenzfallsteht der Käufer von Wertpapieren in der Gläubigerreihe – hinter den Grossbanken.
Internationale Verflechtung
In Deutschland ist die Lage ähnlich. Clearstream verwahrt fast sämtliche inländischen Titel. Juristisch gelten diese im Rahmen der Girosammelverwahrung nicht als Eigentum von Clearstream, sondern als Miteigentum der Anleger am Gesamtbestand, wie im Depotgesetz festgeschrieben. Gleichwohl bleibt der faktische Zugriff auf die Titel abhängig von der technischen Integrität der Verwahrkette und der politischen Stabilität der Marktinfrastruktur. Die Eigentumsverhältnisse bei Clearstream selbst sind ebenfalls klar: Mehrheitsaktionär ist mit 100 Prozent die Deutsche Börse AG, hinter der international operierende Grossinvestoren wie BlackRock, Vanguard und Norges Bank stehen – keine ungewöhnliche Konstellation, aber eine, die die Machtverhältnisse in der Finanzinfrastruktur verdeutlicht.
Die Schweiz hat mit der SIX SIS AG ein vergleichsweise robustes Modell. Das Bucheffektengesetz schreibt vor, dass Bucheffekten als Vermögensobjekte eigner Art (sui generis) gelten, und somit eigentumsähnlich ausgestaltet sind. Im Konkursfall der SIX SIS AG können Anleger ihre Titel absondern. Doch selbst hier wäre ein globaler Zahlungsausfall nicht folgenlos. Die internationale Verflechtung über Euroclear und Clearstream bedeutet, dass Schweizer Titel ebenfalls Teil des transnationalen Netzes sind.
Ein Hinweis auf mögliche Risiken findet sich auch in Schweden. In einem Vertragsdokument der Bank SEB wird darauf verwiesen, dass im Falle eines Wertpapierdefizits kein Absonderungsrecht geltend gemacht werden könne. Der betroffene Kunde würde in einem solchen Szenario voraussichtlich als ungesicherter Gläubiger ohne vorrangigen Anspruch auf die Konkursmasse eingestuft. Sollte sich diese Praxis durchsetzen, würde sie einen Paradigmenwechsel markieren: von der Depotverwahrung mit Eigentumsschutz hin zur haftungsarmen Verfügungsgewalt über fremde Vermögenswerte. Der Vorfall unterstreicht, wie rasch rechtlich gesicherte Positionen durch private Vertragsklauseln unterwandert werden können – weitgehend unbeachtet von Öffentlichkeit und Gesetzgeber.
Ein Konkurs eines Zentralverwahrers würde das Eigentum nicht vernichten, aber den Zugriff darauf.
Ein Konkurs eines Zentralverwahrers würde das Eigentum nicht vernichten, aber den Zugriff darauf. Wertschriftendepots könnten eingefroren, Transaktionen gestoppt, Eigentumsnachweise verzögert werden. Im schlechtesten Fall würde man als ungesicherter Gläubiger auf einen Anspruch aus der Konkursmasse hoffen müssen.
Teil eines fremden Spiels
Ein weiteres Risiko liegt im Schattenhandel mit geliehenen Aktien. Banken und Broker nutzen die bei ihnen eingebuchten Titel häufig für die sogenannte Wertpapierleihe (securities lending) – also die Weitergabe von Aktien an andere Marktteilnehmer gegen Gebühr. Die verliehenen Aktien erscheinen weiterhin im Depotauszug, sind rechtlich aber temporär an Dritte übertragen – häufig Hedgefonds oder Shortseller. In einer Marktturbulenz könnte dies zu massiven Rückabwicklungen führen, bei denen der Anleger das wirtschaftliche Risiko trägt, ohne davon gewusst zu haben. Der juristische Eigentümer ist in dieser Zeit nicht der Depotkunde, sondern der Entleiher – mit allen Konsequenzen im Krisenfall.
Ein vollständiger Kontrollverlust über das eigene Depot zählt zu den zentralen Risiken einer Systemkrise.
Besonders problematisch wird dies, wenn verliehene Aktien während eines Systemausfalls oder eines Konkursverfahrens nicht mehr zurückgeführt werden können. Auch hier zeigt sich: Was im digitalen Finanzsystem als «Eigenbestand» erscheint, kann in Wahrheit längst Teil eines fremden Spiels geworden sein. Es empfiehlt sich, bei seiner depotführenden Bank oder dem Broker schriftlich bestätigen zu lassen, dass man sein Depot nicht für das securities lending zur Verfügung stellen möchte.
Nur ein digitales Versprechen
Der Gedanke, Aktien seien «sicheres Eigentum», ist damit Illusion. Rechtlich sind sie eine elektronische Forderung gegen eine Institution, deren Stabilität auf Vertrauen basiert. Wer wirkliche Verfügungsgewalt behalten will, muss verstehen, dass selbst im Hochglanz der Finanzarchitektur nur ein digitales Versprechen verwahrt wird. Ein vollständiger Kontrollverlust über das eigene Depot zählt zu den zentralen Risiken einer Systemkrise. Wer dieses Szenario vermeiden möchte, hat verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung. Eine direkte Eintragung im Aktienregister schafft eine Form von rechtlicher Verankerung. Schützen kann man sich, indem man seine US-Aktien über das DRS (Direct Registration System) direkt an den Aktienregisterführer der entsprechenden Firma (zum Beispiel Apple) überträgt. Ergänzend rücken Anlageklassen in den Fokus, die keinen Intermediär benötigen. Dazu zählt etwa physisches Gold im eigenen Tresor oder bei professionellen Verwahrstellen ausserhalb des traditionellen Bankensektors. Auch Bitcoin oder tokenisierte Aktien, etwa Realunit, lassen sich in privaten Wallets aufbewahren. Die zugrundeliegende Blockchain basiert nicht auf Vertrauen in Zentralinstanzen, sondern auf kryptografischer Sicherheit und bietet mehr Unabhängigkeit und Eigenverantwortung.
Bildquelle: Arterra Picture Library / Alamy / Alamy Stock Photo